Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision - 10 Jahre Erfolgsgeschichte
Vor rund zehn Jahren hat sich das Revisionsrecht letztmalig und fundamental geändert. Von einer rechtsformabhängigen Prüfung wechselte die Schweiz damals zu einer rechtsformneutralen, zweigeteilten Revisionspflicht. Was anfangs nicht immer unumstritten war, hat sich vor allem im Bereich der eingeschränkten Revision zu einem Erfolgsmodell entwickelt.
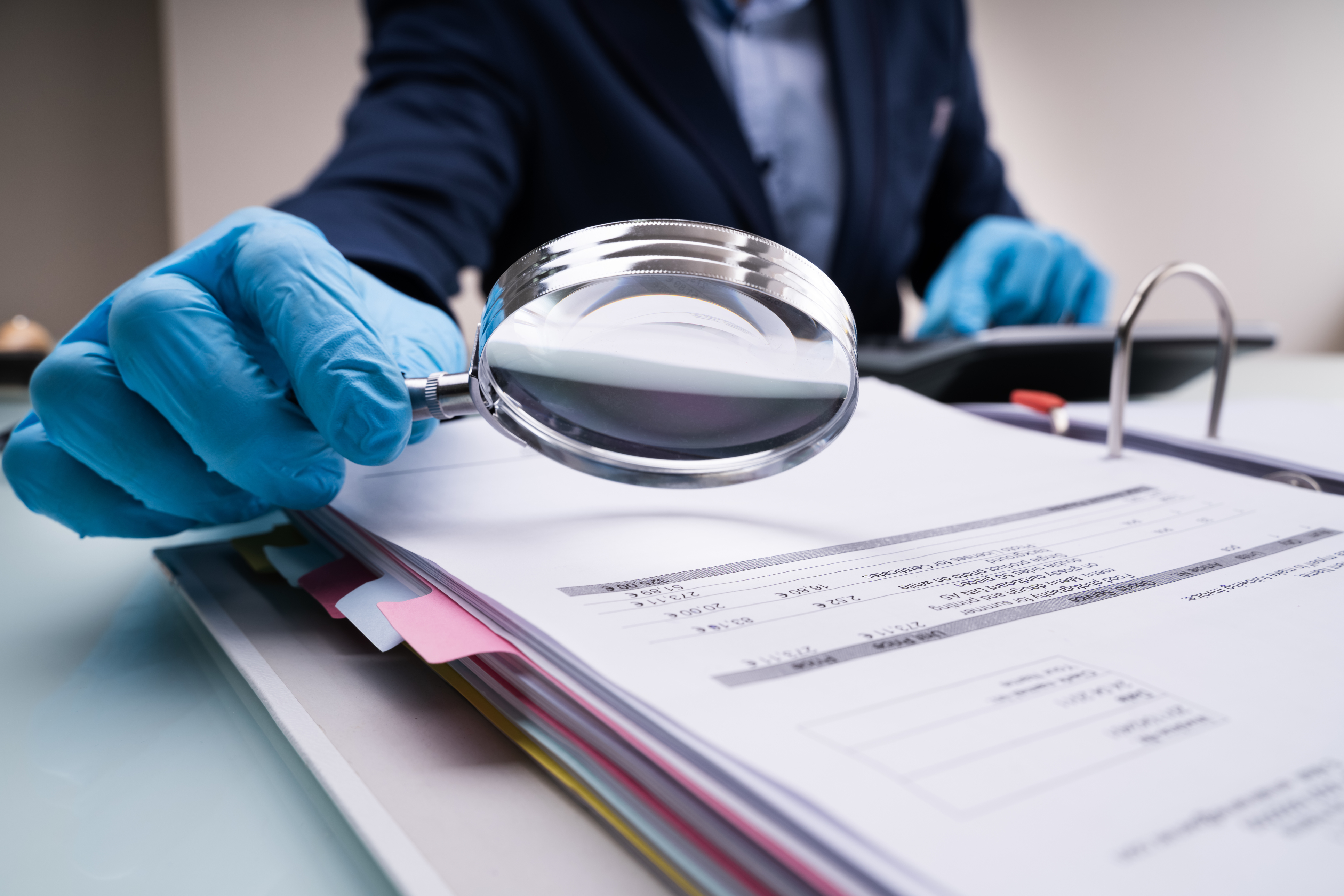
© iStock.com/lovelyday12
Seit dem Geschäftsjahr 2008 kennt die Schweiz die rechtsformunabhängige Prüfungspflicht, welche sich an den Schwellenwerten von Art. 727 des Obligationenrechts (OR) orientiert. Die Branche – und wahrscheinlich noch etwas mehr die Revisionskunden – hatten mit der Einführung dieser neuen Regeln anfangs durchaus ihre Mühe. Vor allem aus Gewerbe- und Industriekreisen wurden Bedenken zur Qualität der Prüfung, vor allem aber zur Steigerung der Prüfungshonorare geäussert. Diese Ängste haben sich definitiv nicht bewahrheitet.
Prüfungsaussage. Auch international ist das Konzept der eingeschränkten Revision nicht immer auf Verständnis gestossen. Die Tatsache, dass der Bericht unter dem Regime der eingeschränkten Revision keine Abnahmeempfehlung mehr enthält, sondern nur noch eine Prüfungsaussage, hat irritiert. Auch die mögliche Doppelmandatierung der Revisionsstelle (mit personeller und organisatorischer Trennung) hat international für Aufsehen gesorgt. Auch an dieser Front konnte jedoch Klarheit und Verständnis geschaffen werden.
Schlanker, gelungener Standard. In der schweizerischen Revisionslandschaft kann die eingeschränkte Revision sicherlich als «Massenphänomen» bezeichnet werden. Anzahlmässig ist diese Revisionsform – nicht zuletzt dank der Anhebung der Schwellenwerte per 1. Januar 2012 – deutlich populärer als ihre grosse Schwester, die ordentliche Revision. Umso mehr erstaunt es, dass diese Revisionsform in einem Standard geregelt werden konnte, welcher (ohne Anhänge) auf gerade einmal 34 Seiten Platz findet. Im Weiteren erstaunt es, dass der Standard, mit einigen kosmetischen Anpassungen im Jahr 2015, seit Anbeginn der Zeitrechnung der eingeschränkten Revision unverändert geblieben ist. Ein sehr erstaunliches Phänomen in der heutigen, volatilen Zeit. Es gebührt sicherlich den Schöpfern des Standards einiges an Lob, dass ihnen ein solches Werk gelungen ist.
Grundsätzlich kann auch nach zehn Jahren Anwendungszeit behauptet werden, dass der Standard bei den Berufskollegen gut ankommt. Gelegentlich hat er aber auch zu Kritik und zu Diskussionen Anlass gegeben. Vor allem hat das Thema Unabhängigkeit in Zusammenhang mit der eingeschränkten Revision immer wieder für rote Köpfe gesorgt. Die im Anhang B zum «Standard zur Eingeschränkten Revision» verankerten Grundsätze (im Übrigen deckungsgleich mit der Richtlinie zur Unabhängigkeit von Expertsuisse) führen regelmässig zu Diskussionen und Fragen. Grundsätzlich tut der Berufsstand gut daran, gerade im Bereich der eingeschränkten Revision mit der Möglichkeit der Doppelmandatierung der Revisionsstelle, sich an klare und einfache Unabhängigkeitsregeln, wie sie im «Standard zur Eingeschränkten Revision» vorgesehen sind, zu halten. Forderungen zu einer Aufweichung dieser Grundregeln könnten sich als Bumerang erweisen.
Feineinstellung des Standards? Der «Standard zur Eingeschränkten Revision» wird in Zukunft sicherlich noch einige Herausforderungen zu bewältigen haben. So können heute nicht alle Prüfungen bei einer grundsätzlich eingeschränkt prüfungspflichtigen Gesellschaft mittels des «Standards zur Eingeschränkten Revision» durchgeführt werden. Gerade im Bereich der Prüfung besonderer Vorgänge sieht sich der Prüfer (wie auch der Prüfungskunde) immer einem Standardwechsel ausgesetzt. Dieser heute notwendige Wechsel kann vielfach nicht immer praktisch begründet werden und dürfte in der Praxis auch das eine oder andere Mal nicht entsprechend umgesetzt werden. Es stellt sich die Frage, ob in Zukunft nicht ein Standard für alle Prüfungsbedürfnisse einer eingeschränkt prüfungspflichtigen Unternehmung geschaffen werden kann oder soll. Dies verständlicherweise auch mit der entsprechenden Auswirkung auf die Zulassung des Revisors. Diesbezügliche Gedanken sind im Berufsstand bereits in Zirkulation.
Alles in allem kann und darf beim «Standard zur Eingeschränkten Revision» von einem Erfolg und einem pragmatischen und leicht handhabbaren Regelwerk gesprochen werden.
Text erschienen im EXPERT FOCUS 11/2018